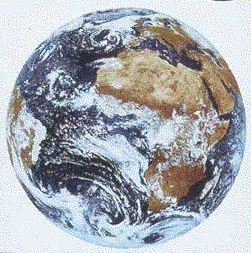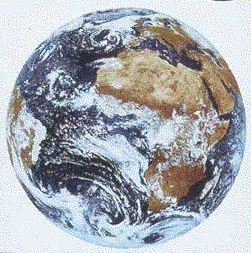Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des Bodenwassergehaltes
auf den CO2 und H2O-Gaswechsel von einjährigen
Buchen (Fagus sylvatica L).
In den Monaten Juni und Juli des Jahres 1998 wurden unter Zuhilfenahme
einer Gaswechselmessapparatur (Typ HCM-1000, Fa. Walz) an neun juvenilen
Pflanzen Gaswechselmessungen unter Dürrestress durchgeführt.
Dabei wurde den eingespannten Blättern verschiedene CO2-Konzentrationen
(1500, 700, 350, 150 und 15 µmol mol-1)
angeboten und deren Reaktionen darauf aufgezeichnet.
Parallel dazu wurde der lehmige Sandboden in den Pflanzencontainern
auf die Veränderung des Wassergehaltes hin messtechnisch überwacht.
Die Messungen des Bodenwassergehaltes zeigten für die einzelnen
Zeiträume einen durchschnittlichen Wert von anfänglich 22,02
(±1, 81) Vol.-%, zwischen dem 8. und 10. Versuchstag 14,29 (±
1.9) Vol.-% und zwischen dem 14. und 18. Versuchstag 8,36 (±2,25)
Vol.-%. Für die entsprechenden Saugspannungen ergaben sich mittlere
Werte von pF 1,10, pF 2,12 und pF 3,37. Der permanente Welkepunkt bei
ca. 6 Vol.-% wurde von den ersten Pflanzen am 18. Tag erreicht, so dass
zu diesem Zeitpunkt eine Wiederbewässerung dieser Pflanzen notwendig
wurde. Aufgrund der unterschiedlichen Austrocknungstoleranz der Buchen
dauerte der Versuch insgesamt 25 Tage. Die gewonnenen Daten ließen
eine Aufteilung in drei Desorptionszeiträume zu, die sich über
den 2. bis 4., 8. bis 10. und 14. bis 18. Versuchstag erstreckten.
Es ließ sich feststellen, dass E, gH2O und An ab einem bestimmten
Wassergehalt von ca.10-12 Vol.-% und einer Bodensaugspannung von ca.
pF 3,0 bis pF 2,5 eine enge Korrelation mit dem Austrocknungszustands
des Bodens aufwiesen. Er wurde zum limitierenden Faktor der Assimilation,
die am 18. Tag bei Bodenwassergehalten um die 6 Vol.-% zum Erliegen
kam. Die ersten Wiederbewässerungen mussten zu diesem Zeitpunkt
durchgeführt werden. Bei einigen Pflanzen konnte nur noch der respirative
Gaswechsel gemessen werden.
Da offensichtlich der Boden in den aufgesättigten Pflanzencontainern
für die Pflanzen zu nass war, konnte bis zum Ende des zweiten Desorptionszeitraumes
bei der Nettophotosyntheserate An eine leichte Erhöhung um durchschnittlich
8% verzeichnet werden. Die Transpiration E hingegen blieb in diesem
Zeitraum nahezu konstant und die stomatäre Leitfähigkeit gH2O
fiel um ca. 4% ab, so dass von dem Erreichen eines Optimums für
die Pflanzen erst im Laufe der ersten Tage des Versuches ausgegangen
werden konnte. Zwischen dem 10. und dem 14. Versuchstag zeigten E, gH2O
und An eine geringe Abnahme, zwischen dem 14. und 16. Tag konnte ein
starkes Absinken der Werte beobachtet werden. Am Versuchsende ließ
sich keine Photosyntheseleistung mehr feststellen.
Fagus sylvatica L. kann von der ansteigenden atmosphärischen CO2-Konzentration
profitieren, wie die An, Ci-Kurven zeigen konnten. Der CO2-Kompensationspunkt
erreichte unter zunehmendem Wasserstress niedrigere Werte. Dieser Vorgang
wurde als eine mögliche Anpassung an die Stresssituation interpretiert.
Es liegt daher die Vermutung nahe, dass sich die Rotbuche Fagus sylvatica
L. unter dem zukünftig zu erwartenden Anstieg des atmosphärischen
CO2-Gehaltes auch in längeren Trockenperioden gut entwickeln kann.