
Arbeitsgruppe Ökologie
der Pflanzen
PD Dr. Manfred Forstreuter
- Klimawandel und Vegetation -
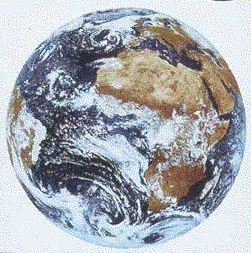
 |
Arbeitsgruppe Ökologie
der Pflanzen |
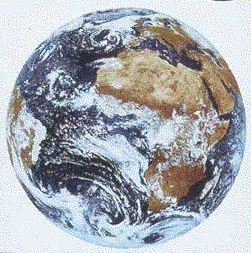 |
  |
Diplomarbeit
ZusammenfassungFür die Feldulme (Ulmus campestris) ist bekannt, dass es bei Eiablage und Fraß durch den monophagen Ulmenblattkäfer (Xanthogaleruca luteola) zu Veränderungen des pflanzlichen Terpenoidstoffwechsels kommt. Die dadurch abgegebenen Duftstoffe wirken nach einer Induktion zwischen 3 Stunden und 120 Stunden auf den spezialisierten Eiparasitoiden Oomyzus gallerucae attraktiv. Diese Veränderung des Sekundärstoffwechsels könnte mit Veränderungen des Primärstoffwechsels einher gehen, denn der Primärstoffwechsel liefert die Energie und die Ausgangsstoffe für den Sekundärstoffwechsel. Veränderungen des Primärstoffwechsels können sich in einer veränderten Photosyntheserate äußern. In der vorliegenden Diplomarbeit sollte untersucht werden, ob sich die Photosyntheseaktivität der Feldulme durch die Eiablage des Ulmenblattkäfers verändert. Hierzu wurden Gaswechsel- und Chlorophyllfluoreszenzanalysen durchgeführt. i) Es wurde die Photosyntheseaktivität systemisch induzierter Blätter von befressenen Feldulmen, befressenen und eierbelegten Feldulmen sowie die Photosyntheseaktivität entsprechender Blätter von Feldulmen ohne Befall nach 72 Stunden untersucht. ii) Um eine Zeitkomponente eines eventuell unterschiedlichen Verhaltens der Photosyntheseaktivität als Reaktion auf Herbivorenbefall während der Induktionszeit von 72 Stunden auf zu zeigen, wurde mittels automatischer Gaswechseldauermessungen beobachtet, ob sich die Photosyntheserate und die Atmungsrate systemisch induzierter Blätter von befressenen und eierbelegten Feldulmen gegenüber Kontrollpflanzen verändert. iii) Da für die Duffstoffabgabe bei befressenen und eierbelegten Feldulmen eine acropetale Induktionsrichtung nachgewiesen ist, wurde durch Chlorophyllfluoreszenzmessungen an Blättern entlang der Sprossachse auf eine acropetale Induktionsrichtung der eventuell veränderten Photosyntheseaktivität getestet, d.h. Blätter oberhalb des Befalls, Blätter im Befallsbereich und Blätter unterhalb des Befallsbereichs wurden untersucht. iv) Um zu prüfen, welchen Einfluss die Terpenoidbiosynthese auf die Photosyntheserate von Feldulmen hat, wurde mit Gaswechselmessungen und Chlorophyllfluoreszenzanalysen die Photosyntheserate systemisch induzierter Blätter von in ihrer Terpenoidbiosynthese durch 30 µmol Fosmidomycin und Cerivastatin gehemmten und nicht gehemmten Hydrokulturpflanzen (jeweils befressen und eierbelegt) gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass i) die Nettophotosyntheseraten der aufgenommenen Gaswechselkennkurven von befressenen und eierbelegten Feldulmen nicht signifikant unterschiedlich im Vergleich zu denen von ausschließlich befressenen Feldulmen und Kontrollpflanzen sind. Die Chlorophyllfluoreszenzmessungen deuten lediglich eine tendenziell erhöhte Photosyntheseaktivität von befressenen Feldulmen gegenüber befressenen und eierbelegten Feldulmen und Kontrollpflanzen an. ii) Während einer Induktionszeit von 72 Stunden gibt es in der Nettophotosyntheserate und der Atmungsrate sowohl zwischen den Tagen bzw. Nächten einer Behandlungsgruppe als auch zwischen Kontrollpflanzen und befressenen und eierbelegten Feldulmen keine signifikanten Unterschiede. iii) Da es keine signifikante Veränderung der Photosyntheserate durch Fraß und Eiablage des Ulmenblattkäfers gibt, kann mittels Chlorophyllfluoreszenzanalysen auch keine acropetale Induktionsrichtung einer veränderten Photosyntheseaktivität entlang der Sprossachse nachgewiesen werden. iv) Die Untersuchungen an Terpenoidbiosynthese gehemmten und nicht gehemmten Pflanzen unterstützen die Ergebnisse der unveränderten Photosyntheserate von befressenen und eierbelegten Feldulmen gegenüber Kontrollpflanzen. Gaswechsel- und Chlorophyllfluoreszenzanalysen ergeben keinen signifikanten Unterschied in der Photosyntheseaktivität zwischen in ihrer Terpenoidbiosynthese gehemmten und nichtgehemmten Feldulmen (jeweils 72 Stunden induziert durch Fraß und Eiablage des Ulmenblattkäfers). Die Terpenoidbiosynthese scheint damit keinen Einfluss auf die Photochemie der Feldulme zu haben. Da bisher in tritrophischen Systemen der Einfluss von Eiablagen herbivorer Insekten auf die Photosyntheseaktivität nur an gymnospermen Bäumen wie der Kiefer untersucht wurde, stellen diese Untersuchungen eine Pilotstudie an angiospermen Bäumen wie der Feldulme dar. Die vorliegenden Ergebnisse werden im bisher bekannten Kontext von Reaktionen des Primärstoffwechsels auf Herbivorie diskutiert. Die Reaktion des Primärstoffwechsels auf Herbivorie kann sich unterschiedlich äußern. Bei einigen Pflanzenarten verändert sich die Photosyntheserate in Reaktion auf Herbivorie, bei anderen wie bei der Pappel bleibt sie gleich. Letztere zeigt eine Veränderung in der Allokation von Assimilaten. Um potenzielle Mechanismen der Reaktion auf Herbivorenbefall wie z.B. bei der Pappel auch in der Feldulme aufzudecken und um weitere Einblicke in die Ökophysiologie der Feldulme zu erhalten, werden ausblickend weitere Studien angeregt. |
Statistik
 |
Stand:08.01.2011 | Autor:Manfred.Forstreuter@fu-berlin.de | Haftungsausschluss |